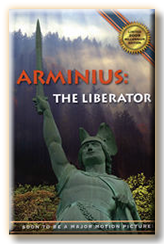Das Heer des ARMINIUS
Bewaffnung und Kriegswesen
Der germanische Heerbann zu ARMINs Zeiten war kein stehendes Heer; das war gegenüber den Römern ein Hauptnachteil. Kriegsdienst war eher ein Recht der freien Männer, als eine Pflicht. Dieses Volksheer – mehr eine Miliz -, zu dem jeder Waffenfähige bereits vom 12. Lebensjahr an bis zum rüstigen Greis gehörte, wurde nur im Falle kriegerischer Ereignisse einberufen und wählte sich selbst, je nach Fähigkeit und Vertrauen, aus edlem Geschlecht den Heerführer, den Herzog. Dieser war als militärischer Führer nicht mehr als Primus inter pares, ein Erster unter Gleichen. Das Ende des Krieges beendete dann auch dessen militärischen Auftrag - eine Art Sicherung gegen die ständige Machtausübung eines Einzelnen und dessen Sippe. König Marbod bildete eine Ausnahme.
Ob ARMINIUS jemals versucht hat, wie jener ein stehendes Heer aufzustellen, ist unbekannt. Als Voraussetzung hierzu hätte es einen Ort zentraler Machtkonzentration geben müssen, der nicht vorhanden und wohl auch nicht erwünscht war.
Die entscheidende Kampftruppe bildete das Fußvolk. Die Reiterei erlangte im taktisch-gemischten Zusammenwirken mit ihm oft schlachtentscheidende Wirkung. Exerzieren im großen Verband, wie bei den Römern üblich, kam für freie Germanen nicht in Frage, das war nur in einem stehenden Heer möglich. Diesbezügliche Bemühungen des ARMINIUS wären an dem ausgeprägten Individualismus seiner Landsleute gescheitert. Erst vom Jahr 17 wird von einer Angleichung an römisches Gefechts-Exerzierreglement berichtet.
Die Kampftaktik der Germanen richtete sich vorwiegend nach dem Gelände. In unübersichtlichen bewaldetem oder bergigem Gebiet, in Schluchten und Geländeengen – also überall dort, wo der Gegner gezwungen war, die Marschordnung auseinanderzuziehen, und somit außerstande, sich frei zu entfalten, wo man ihn aufsplittern und dann einzeln bekämpfen konnte – zwangen sie ihm das Gesetz des Handelns auf.
Im freien Gelände setzten sie alles auf Angriff. Im ersten Gewaltansturm tief nach hinten gestaffelter Kriegermassen sollte der Sieg errungen werden; nicht die Stärke der Waffen, sondern die Götter entschieden. Sie urteilten über Leben und Tod, Sieg oder Niederlage; ihrem Schiedsspruch hatte man sich bedingungslos zu fügen. Krieg trug bei den Germanen tiefen religiösen Charakter.
Wie ihre Taktik waren auch ihre Hauptwaffen (Lang- und Kurzschwert, Axt, Speer und Schleuder) auf Angriff ausgerichtet. Die Bogenwaffe, die mehr zur Verteidigung taugte, war eher untergeordnet, spielte jedoch im Guerillakampf und als Waffe aus verdecktem Hinterhalt eine Rolle.
Nur etwa ein Viertel einer Hundertschaft besaß ein Schwert, die Masse der Krieger war nur mit Lanze und Schild ausgerichtet. Der Speer, die “Frame” aus Eichen oder Eschenholz, diente als Stoß- und Wurfwaffe sowie als Sprunghilfe über Geländehindernisse.
Die Spitze war nicht immer aus Metall, sondern wurde oft nur durch Abbrennen des weicheren Außenholzes im Feuer “gehärtet”; die durch sie verursachten Verletzungen waren nicht weniger gefährlich und kamen einem Bajonettstich gleich.
Die eher kleinwüchsigen Römer fürchteten nichts mehr als den brausenden Sturmlauf der halbnackten Kriegerhaufen, wenn die “hünenhaften” Germanen hinter ihren erhobenen Schilden den “Barritus”, den nicht minder gefürchteten Schlachtgesang, anstimmten, der hierdurch noch mächtiger erklang.
An vorderster Spitze kämpfte der Fürst, der Herzog, zusammen mit seiner durch Treueschwur unlösbar verbundenen Gefolgschaft – auserwählte junge Männer -, dahinter in immer breiteren Reihen die durch Verwandtschaftsbande festgeschlossenen Sippengenossen, wo jeder für den anderen mit seinem Leben einstand. Der gegenseitige Treueschwur band die Gefolgschaft stärker als befohlene Pflicht und geforderter Gehorsam.
Müßten heute die politischen Drahtzieher moderner Kriege gleichfalls im ersten Glied des “Keils” kämpfen, so sähe unsere Welt wohl friedlicher aus!
Einen Helm oder Panzer zu tragen galt als feige, es gab damals auch noch keine eigene “Rüstungsproduktion”, obwohl einheimische Schmiede als besonders kunstfertig galten.
Die relativ leichten germanischen Schilde sind mit den schweren römischen, die fast den ganzen Körper bedeckten, nicht zu vergleichen. Es gab runde, ovale und eckige Formen; ob man daraus die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm ableiten kann, ist unbekannt. Sie waren aus ziemlich dünnen, mit Leim (Birkenteer) (1) zusammengefügten Brettern gebildet und mit einer bronzenen oder eisernen Randeinfassung versehen. Es gab Schilde mit einer Leder- oder Fellbespannung und mit verstärkenden schmückenden Beschlägen – also eine vielfältige Gestaltung. Allen gemeinsam war ein metallener Schildbuckel, der die haltende Faust schützen sollte und rund oder spitz ausgebildet war, um Schwerthiebe abfangen zu können; zusätzlich diente er auch als Stoßwaffe.
(1) Birkenteer ist der Kraftkleber der Frühzeit; er wurde durch Verschwelen
von Holz und Rinde der Birke gewonnen.
Der Germane pflegte seinen Schild, zu dem er ein fast persönliches Verhältnis hatte, zu bemalen, vielleicht mit den Farben der betreffenden Sippe oder des Stammesverbandes. Besonders beliebt waren die Heilszeichen, die dem Träger Schutz und Glück bringen sollten. Das waren Tierbilder und Wahrzeichen der Götter, wie zum Beispiel Schlange und Wolf Wodans, Bär und Bock Donars und der Widder Zius. Für Wodan war der Speer, für Donar der Hammer, für Ziu das Schwert charakteristisch. Als Farben verwandte man Ruß, Tierblut, Kalk, Waid, Eisenoxyd und bestimmte Pflanzenwurzeln, die auch zum Färben von Textilien benutzt wurden (die Farben: Blau, Rot, Lila, Gelb, Schwarz, Weiß). Den Schild zu verlieren galt als große Schande, als wenn sein Träger die Ehre verloren hätte – er durfte dann weder an religiösen Feiern noch am Thing teilnehmen. Mancher, der so mißachtet wurde, nahm lieber den Strick (TACITUS, Germania 6).
Die Masse derjenigen Kämpfer, die nur im Notfall zusammengezogen wurden, besaß aus Weidenruten geflochtene Schilde, die sich die Krieger vielleicht erst kurz vor dem Einsatz anfertigten. Sie boten nur bedingt Körperschutz.
Im Kampf selber entledigten sich die Krieger ihrer Oberbekleidung, des Mantels und Kittels, um ungehinderter kämpfen zu können – für die von Kopf bis Fuß gerüsteten Römer ein gewiß ebenso schockierender wie furchterregender Eindruck gewaltiger männlicher Kraft und Wildheit.
Römische Bildhauer haben uns das Bild des kämpfenden germanischen Kriegers in bewunderungswürdiger, künstlerischer Gestaltung und einer bemerkenswerten Objektivität überliefert. Niemals versagen sie dem barbarischen Gegner eine gewisse Würde; nie zeigen sie ihn deklassierend oder verfälscht, auch wenn jener als Gefangener oder als Unterlegener dargestellt wird.
Im Gegensatz zu unserer Zeit waren sich die Römer sehr wohl bewußt, daß man die Leistung und den Ruhm der eigenen Truppe verkleinert, wenn man einen tapferen Feind niederträchtig herabwürdigt.
Erfahrung im Bau von Festungswerken im römischen Sinne besaßen die Germanen nicht, auch nicht im Kampf um befestigte Plätze; deshalb unternahmen sie fast nie etwas gegen ein vollbelegtes, mit Defensivwaffen bestücktes Legionslager. Auch waren ihnen Belagerungsmaschinen und -methoden unbekannt. Dagegen brachten sie es zu beachtlichen Leistungen in der Erstellung von eindrucksvollen Rundanlagen und grabenumwehrten Fluchtburgen in Holz-Erde-Konstruktion.
Das läßt auf planmäßiges Zusammenwirken massenhaft aufgebotener Arbeitskräfte schließen. Von gleicher Bauweise waren schnell errichtete Sperriegel und Hinterhaltbastionen in bergigem Gelände und Pässen oder an geeigneten Stellen in Moor und Sumpf.
Ihre vergleichsweise leichte Ausrüstung konnte aber auch von Vorteil sein, ja sogar Überlegenheit in bestimmten Gefechtslagen bewirken. Sie erlaubte gegenüber den schwerbewaffneten und weit mehr belasteten Legionären eine wesentlich höhere Beweglichkeit und Schnelligkeit. Es ist überraschend, wie oft ARMINIUS auch unvorhersehbaren römischen Aktionen durch rasches Reagieren zuvorkommt. Während sich eine gepanzerte römische Truppe in schwierigem, unübersichtlichem Gelände nicht wie in offener Feldschlacht formieren und entfalten kann, sind die Germanen in Bewegung, können pausenlos angreifen, indem sie abgekämpfte Teile aus der Front ziehen und durch frische Reserven ersetzen; der Gegner jedoch kommt nicht zur Ruhe und wird zermürbt.
So vermag ein einfaches Volksheer unter guter Führung einexerzierten Berufssoldaten das Gesetz des Handelns aufzuzwingen. Dies kann schlachtentscheidend sein. Was außerdem den militärisch weit unterlegenen germanischen Kräften entgegenkommt, ist, daß mehrere positive Umstände zusammentreffen, die ihnen mit zum endlichen Erfolg verhelfen. Vor allem die Kampfmoral des germanischen Kriegers war eine gänzlich andere als die des römischen Söldners. Im vertrauten Heimatgebiet kämpfte er unmittelbar vor den Augen seiner Sippengemeinschaft. Im festen Vertrauen auf seine Götter und auf seine von göttlichem Heil (“Ratheil”- “Wortheil”- “Kampfheil”) begnadeten Führer setzte er sein Leben ausschließlich für das Wohl und die Freiheit seiner Familie und seines Stammes ein. Er wußte, Niederlage bedeutete für alle – nicht nur für ihn selbst – unweigerlich Unterwerfung, Sklaverei, Deportation, Ausrottung, Schändung der Heiligtümer. Dieses Wissen motivierte ihn zu höchstem, schonungslosen Einsatz. Reiche Beute war ein Geschenk des Kriegsgottes. Den Frauen oblag die Versorgung der Kämpfenden und der Verwundeten. Schwerverwundete und Gefallene wurden, wenn irgend möglich, geborgen und vor dem Zugriff des Feindes bewahrt. In größter Not griffen auch Frauen zur Waffe. Wer im Kampf gefallen war, auf den wartete ein sicherer Platz in Walhall, jenem germanischen “Himmel”, der einer großen Banketthalle glich, wo man unter seinesgleichen wacker zechen oder sich mit frischfröhlichen Kampfspielen unterhalten konnte und von schönen Walkürenmädchen liebevoll betreut wurde.
Die Legionäre hingegen, aus einer Vielzahl verschiedensten Völkerschaften rekrutiert, waren unter der gestrengen Fuchtel ihrer Centurionen eiserner Disziplin unterworfen. Fern der Heimat, in einem unheimlichen, von endlosen Wäldern und Mooren bedeckten Land, unter rauhen, ungewohnten Witterungsverhältnissen, mußten sie ihre Haut gegen wilde und unberechenbare Einwohner verteidigen. Wurden sie nach 20 Jahren Kriegsdienst (es gab sogar Veteranen mit 30 Kriegsjahren) als Krüppel oder von Krankheit geplagt in die Heimat entlassen, galten sie dort – kamen sie nicht reich zurück – als der letzte Abschaum. Ihre Kampfmoral gründete sich auf Macht und Ruhm des Imperiums, und Offiziere wie Mannschaften strebten nach Geld, Sklaven, wertvollen Auszeichnungen, Orden und Beförderung. Die reine Gier nach Beute muß besonders die fremdländischen Hilfstruppen angetrieben haben.
Ein Verpflegungsproblem wie das der Gegner, die überhaupt nur durch ständige Versorgung riesiger Trosse lebens- und kampffähig waren, wird es in der kämpfenden Truppe des ARMINIUS so gut wie nicht gegeben haben. Jeder Mann wird – ähnlich wie die Soldaten aller Zeiten – daran gewöhnt gewesen sein, ein paar Tage “aus dem Brotbeutel” – auch aus dem der Gefallenen - zu leben. Im übrigen werden die Verpflegungstrosse der Legionen und das von ihnen mitgeführte Schlachtvieh mit die allererste Beute der Angreifer gewesen sein. Außerdem – war das Korn geerntet – konnte man notfalls mit jeglicher Unterstützung durch die örtliche Bevölkerung rechnen.